Vom 19. – 21. Januar 2018 trafen sich Biographen und Biographinnen des Biographiezentrums (ganz schön viel Biographie – es ist aber auch ein schönes Wort) in der Mohrvilla in München/Freimann zu einer kollegialen Fachtagung, die mit einer wunderbar gelungenen Soiree und Matinee im Gewölbesaal ihren krönenden Abschluss fand. Bevor ich mich dem Thema der Überschrift widme, ist es mir eine Herzensangelegenheit zu betonen, dass es sich lohnt, einer solchen Lesung beizuwohnen. Ob als lesende/r Biograph/in, als dessen Auftraggeber oder als Hörer. Das Potpourri aus Privatbiographien, die unterschiedlichen Lesarten und die Stimmung des Publikums ergaben einen wunderbaren Resonanzkörper, der in den anschließenden Gesprächen einen inspirierenden Nachhall fand. Da die Lesung professionell vertont wurde, steht in Kürze ein Band zur Verfügung, um alle Beiträge nachzuhören. Nochmal: Es lohnt sich! Reinkommen! Reinhören!
An dieser Stelle ein großer Dank an alle Mitglieder, die das Event – und kommende – geistig und finanziell mittragen und natürlich an Dr. Andreas Mäckler und Andrea Richter, die es organisiert und ausgerichtet haben.
Ist Biographie Therapie? Und was macht die Therapie mit Biographie?
Diese Frage, bzw. die Frage nach der Abgrenzung zwischen Biographie und Therapie wurde im Kollegenkreis diskutiert. Nicht nur die Verwirrung, dass Psychologen vermehrt Biographie-Kurse anbieten, auch der Umgang mit Gefühlsausbrüchen oder auftauchenden Traumata während und nach der Biographie-Arbeit stellte sich bei der oben genannten Fachtagung als Thema. Ich selbst bin Therapeutin und Biographin und habe mir oft die Frage nach der Abgrenzung gestellt, auch in der Überlegung, ob es Biographie-Klienten abschreckt, eine Therapeutin vor sich sitzen zu haben. Nun muss man vorausschicken, dass in der Regel die Biographie-Arbeit ein schöner, belebender und bereichernder Prozess für den Auftraggeber und den Biographen ist. Natürlich kostet er Zeit, ob es die reale Zeit betrifft, wie die Interview-Termine, das Text- und Bildersichten oder jene Zeit, sich den eigenen Erinnerungen zu widmen. Dass daraus ein kostbarer Schatz entsteht, darf man sich immer wieder – wie einen wertvollen Begleiter – zur Seite stellen. Es kommt aber auch vor, dass schmerzhafte Begegnungen oder Ereignisse erinnert werden. Und manche davon zeigen sich ungefragt, ungebeten und schonungslos.
In der Therapie – zumindestens in einigen Therapieverfahren – wird in die vergangene Erfahrungswelt des Klienten geschaut. Dort sucht man gemeinsam zum einen nach Ressourcen, die sich zur Lösung des Problems des Klienten eignen, man sucht aber auch nach Ressourcen, die sich aus verschiedenen Gründen bislang nicht gezeigt haben, um sie für den Klienten nutzbar zu machen. Und dann forscht man nach vergangenen Verletzungen, die der Klient gefühlsmäßig (bewusst oder unbewusst) so verknüpft hat, dass daraus ein von ihm empfundenes Fehlverhalten bzw. Fehleinschätzungen entstanden sind und in den heutigen Beziehungen zu Konflikten führen. Diese biographische Arbeit findet während der Therapiesitzungen statt, oft verhält es sich aber auch so, dass der Therapeut dem Klienten dies als Aufgabe (u.a. Erstellung eines Genogramm) während der gemeinsamen Zusammenarbeit anbietet. Es hat sich gezeigt, dass das Verstehen, Annehmen und Neubewerten der eigenen Lebensgeschichte einen lösenden und heilsamen Effekt hat. Der Therapeut steht dem Klienten dabei als empathische, zugewandte, vertraute Reflexionsfläche gegenüber und zur Seite.
In der Biographie-Arbeit kommt der Klient zunächst mit der Bitte, seine Geschichte, ob Lebensgeschichte, Erzählungen, Anekdoten u.v.m. aufzuschreiben. Das bedeutet, ihr auf dem Papier ein Gesicht, einen Körper zu geben. Der Biograph stellt nicht das damit verbundene Gefühl in den Vordergrund einer Reflexion, sondern das gelebte Leben. Das heißt nicht, dass das Gefühl nicht wichtig ist, denn es ist das Transportmittel, um die Geschichte an den Leser zu übermitteln. Der Biograph ist dabei ein wertschätzendes Gegenüber, das Fakten sammelt, ihnen einen Rahmen und damit eine Bedeutung gibt. Was der Klient aus dem Prozess für sich lernt, liegt in seiner eigenen Verantwortung. Hier wird also nicht ein Gefühl evoziert, um Veränderungsarbeit möglich zu machen, sondern Geschichten mit Gefühl erzählt. Dennoch hat auch diese Arbeit, gerade wenn sie fertiggestellt ist, eine Auswirkung auf den Klienten, die oft mit Erstaunen, Stolz, Stärke und Freude verbunden ist.
Fazit: Therapeut und Biograph handeln nach einem Auftrag. Den gilt es abzuklären, zu definieren und anschließend, im jeweiligen Berufsfeld, dieses Ziel zu erreichen.
Biographie und Therapie – Freunde aber keine Kollegen
Mir gefällt das Bild des Therapeuten, der für den Klienten ein Baum ist, an dem er einkehren kann und unter dessen Schutz er neue Wege in seine persönliche (Lebens-)Welt entdeckt. Die Biographie-Arbeit ist dabei ein Zaungast, ein Vöglein, das mit Briefen aus der Vergangenheit im Schnabel in die Krone einkehrt, die der Klient erinnern und verarbeiten kann aber nicht muss. Das liegt in seiner Verantwortung. Der Biograph hingegen ist für den Klienten sein Kurator, der dafür Sorge trägt, die Lebensgeschichte des Klienten als sein „Kunst“-Werk in einen geeigneten Rahmen (Worte, Buchform etc.) einzupflegen, damit es an dem Ort, wo es „ausgestellt“ wird (für sich, die Kinder, die Öffentlichkeit etc.), Würdigung erhält.
Therapeuten schreiben nicht die Lebensgeschichte ihrer Klienten auf und Biographen arbeiten nicht die Traumata ihrer Klienten auf. Hier gibt es eine klare und wichtige Grenze, der beide professionell begegnen müssen, unter Umständen auch, indem sie dies mit dem Klienten ansprechen. Sollten bei der Erstellung der Biographie starke emotionale Themen auftreten, ist der Biograph ein wertschätzender Zuhörer, aber immer auch ein Ratgeber, sich gegebenenfalls an anderer Stelle therapeutische Unterstützung zur Aufarbeitung zu holen. Auch ich respektiere diese Grenze. Als Biographin bin ich nicht Therapeutin, diese tritt in den Hintergrund, auch wenn ich sie natürlich nicht abspalte. Da die Biographiearbeit oft wie eine „Freundschaft auf Zeit“ empfunden wird, wie meine Kollegin Frau Dr. Claudia Löschner so schön ausdrückte, ist eine Therapie – auch anschließend – i.d.R. bei mir als zuvor begleitende Biographin nicht empfehlenswert. Und umgekehrt. Aus einem therapeutischen Setting sollte kein biographisches entstehen, das zu Konfusionen führen könnte. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie man so schön sagt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Wenn man sich also der Regeln bzw. Parameter bewusst ist, steht einer guten und erfolgreichen Zusammenarbeit nichts im Weg.
Susanne Donalies-Zeiler, www.carpe-ideas.de
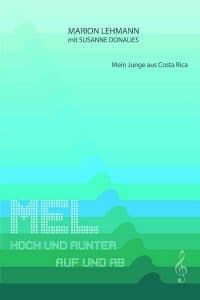
„MEL – hoch und runter, auf und ab. Mein Junge aus Costa Rica.“, von Marion Lehmann mit Susanne Donalies-Zeiler, 2018


Kommentar hinterlassen